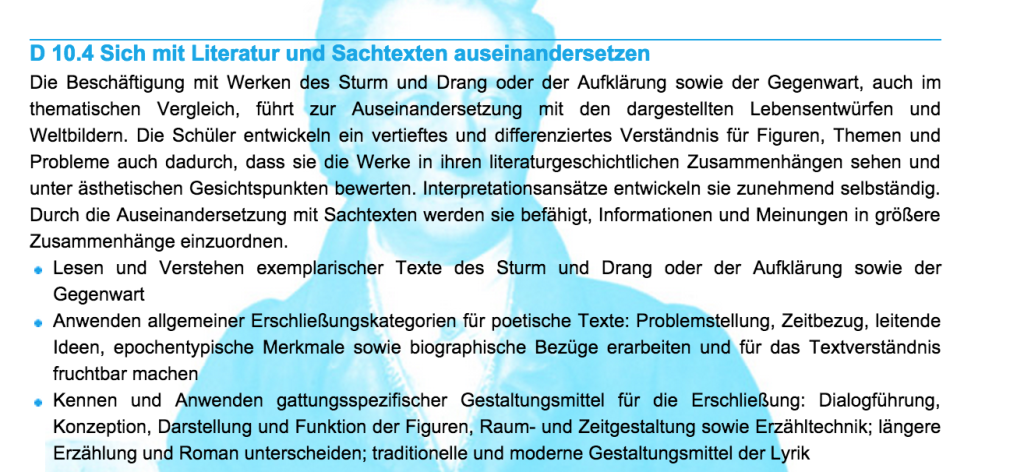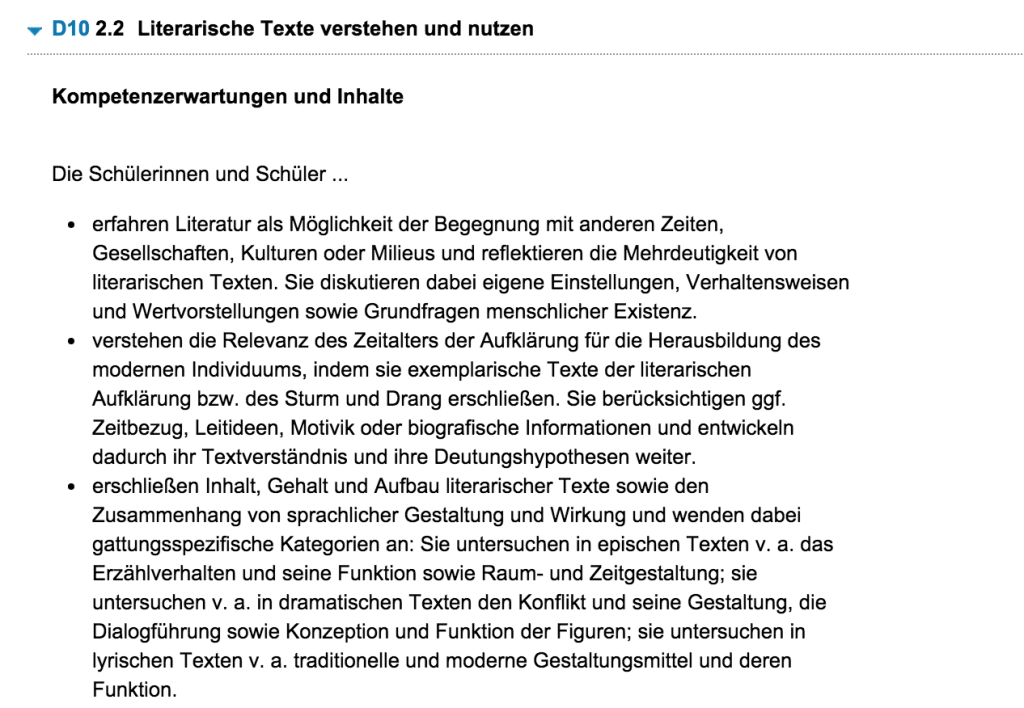Eine Bemerkung zur Kompetenzorientierung
Gestern entwickelte sich auf Twitter eine teils latent, teils offen aggressive Diskussion zum Thema Kompetenzorientierung. Ausgangspunkt war dieser Tweet von Torsten Larbig:
Ich habe mich an diesem Tweet aus zwei Gründen gestört: Er setzt »großes Faktenwissen« – nicht Wissen – an erste Stelle im Lernprozess und konstatiert eine Beliebigkeit bei der Formulierung von Kompetenzen (»irgendwas«).
Kompetenzen sind für mich in der Schule etwas Selbstverständliches: Sie stellen sicher, dass Lernprozesse erfolgen und relevant sind, weil Lernende sie deshalb durchlaufen, um etwas Bestimmtes zu können. Dennoch stehen viele praktische Arrangements und die Prüfungskultur der Umsetzung von Kompetenzorientierung im Weg.
Betrachten wir das an einem Beispiel – einem Auszug aus dem Bochumer Modell literarischen Verstehens, das Jan Boelmann in seinem Aufsatz über Empirische Ergebnisse zur Behandlung von narrativen Computerspielen im Deutschunterricht zitiert (2013):
Teilkompetenz »Narrative und dramaturgische Handlungslogik im thematischen Zusammenhang verstehen«
Niveau III: Reflektieren und Bewerten
Operationalisierung: Funktion und Aufbau der Handlungslogik bewerten / Sachverhalte auf die eigene Lebenswelt übertragen / zur Handlung Stellung nehmen
Prozesse: komplex begründen Konstruktion des Textes durchdringen / komplexes Vorwissen einbringen […]
Was passiert hier genau? Es wird formuliert, was Lernen bedeutet, welches Ziel Lernende erreichen sollen. Wie sie dieses Ziel erreichen, ist sekundär: Während bestimmt wird, dass Vorwissen eingebracht werden soll, wird nicht festgelegt, welches Vorwissen das sein muss. Weil eben die Lerngegenstände von Lehrkräften oder gar Lernenden gewählt werden können: Ob Computerspiele, Fernsehserien oder Romane in Bezug auf die verwendeten narrativen und dramaturgischen Verfahren analysiert werden, spielt keine Rolle.
In der Diskussion kam der Vorwurf auf, Kompetenzorientierung sei etwas, was Lehrkräften von theoriegetriebener Forschung aus aufgedrängt werde. Das mag in vielen Kontexten so erscheinen. Die Theorie-Praxis-Spaltung, die an pädagogischen Hochschulen von Studierenden schon vom ersten Semester an betrieben wird und sich bis zu Lehrkräften im Ruhestand durchzieht, ist in meiner Wahrnehmung aber letztlich Ausdruck einer mehrfachen Überforderung oder Verweigerung:
- Lerntheorie fordert mich auf, über mein eigenes Lernen und meine Lernbiografie nachzudenken.
- Sie zwingt mir eine Reflexion meines pädagogischen Handelns auf.
- Sie fordert mir Transferleistungen ab, weil sie keine praktischen Rezepte anbietet, sondern Einsichten, deren Umsetzung nicht klar ist.
- Sie erfordert argumentatives und begriffliches Denken, das auch in Widerspruch zur Ritualen der Praxis treten kann –
- und dann von mir Widerstand in Bezug auf Vorgesetzte, Regeln und Traditionen verlangt.
Ich habe Verständnis für diese Art von Überforderung und Verweigerung. Aber sie darf nicht dazu führen, dass die Fachdidaktik ihre Ansprüche senkt und Modelle so verändert, dass sie dem aktuellen Schulalltag entsprechen, weil es dann für Lehrkräfte einfacher ist, eine bestimmte Terminologie zu verwenden. Wenn Kompetenzorientierung letztlich nicht mehr ist als ein neues Wort für dasselbe schulische Lernen, dann bringt sie nichts. Lehrkräfte weisen viel Erfahrung auf – das befreit sie aber nicht davon, gewonnen Erkenntnisse argumentativ zu verhandeln.
Deshalb mein Nein: »Faktenwissen« kommt nicht zuerst, wenn Kompetenzorientierung ernst genommen wird – Können kommt zuerst. Kompetenzorientierung bedeutet, die Lernenden zu fragen, ob sie etwas können und wie sie zeigen können, dass sie es können. Weil ich als Lehrender nicht mehr zwingend sagen kann, auf welchem Weg dieses Können zu erreichen ist. Dass dieses Können mit Wissen und Motivation gekoppelt ist, steht in jeder Kompetenzdefinition. Wer sich damit auseinandersetzt, weiß das. Tut das eine Lehrkraft nicht, ist das zunächst einfach einmal ein Zeichen dafür, dass sie sich nicht mit Kompetenzorientierung beschäftigt hat. Fehlt diese Bereitschaft, müssen zuerst die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.
Dass dies die Bedeutung von Kompetenzorientierung ist, kann aus meiner Sicht nicht sinnvoll diskutiert werden. Das heißt aber nicht, dass keine Kritik daran möglich ist. Für ein AMV-Themenheft habe ich 2011 Beiträge kuratiert, die Kompetenzorientierung sehr kritisch beleuchtet haben. Die für mich wichtigsten Kritikpunkte:
- Kompetenzorientierung darf nicht dazu führen, dass Kompetenzen standardisiert oder mit einfachen Testverfahren operationalisiert werden – weil das der Kompetenzvorstellung in vielen Fällen widerspricht.
- Kompetenzen müssen mit Wertereflexion verbunden werden, weil die nicht automatisch erfolgt.
- Ein zu enger Kompetenzbegriff führt zu einem abstrakten und damit beliebigen Können – das ist aber oft Resultat von 1.
* * *
Ergänzung 30. Juni 2015:
Eine Kompetenzformulierung, die Inhalte festschreibt, bedroht den Wert der Einsicht, dass letztlich das »Empowerment« oder die Handlungsfähigkeit von Lernenden Ziel des Bildungsprozesses sein soll. Als Beispiel dazu ein Auszug aus den Lehrplänen für das Gymnasium in Bayern, Fach Deutsch, 10. Klasse (alt / neu). Zu bemerken ist, dass auch im alten Lehrplan Kompetenzen formuliert werden (»Die Schüler erwerben ein vertieftes und differenziertes Verständnis für Figuren, Themen und Probleme…«) – aber wie im neuen Lehrplan konkrete Inhalte und Methoden vorgegeben werden.
Dadurch wird die Kompetenzorientierung nicht in ihrer vollen Kraft umgesetzt, weil die Idee eines Bildungskanons (z.B. literaturgeschichtliche Epochen) beibehalten wird.